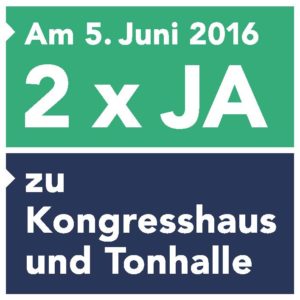Peter Hagmann
Der Mann als solcher
Mozarts «Entführung aus dem Serail» im Opernhaus Zürich
Keine Sorge, das Opernhaus Zürich benötigt in den kommenden Wochen und Monaten keinen besonderen Schutz. Es bringt zwar Wolfgang Amadeus Mozarts Oper «Die Entführung aus dem Serail», in der es auch um die verschiedenen Gesichter des Islam geht, doch davon ist an diesem Abend nicht die Rede. Es ist überhaupt nicht die Rede. Vom Libretto wird Mozarts Oper zwar ein «Singspiel in drey Akten» genannt, in Zürich aber ist der Sprechtext von Christoph Friedrich Bretzner in der Einrichtung von Johann Gottlieb Stefanie dem Jüngeren – zur Gänze gestrichen. Umstandslos folgen sich die insgesamt 21 Arien, Ensembles und Chöre. Verbunden werden sie durch das szenische Geschehen, das vollkommen stumm bleibt, vor allem aber durch die eigenartigen Geräusche von Malte Preuss; ihr Summen und Brummen erinnert an die «Truckera», jenes Hintergrundrauschen, das John Cage für seine «Europeras» ersonnen hat, indem er Hunderte von Opernaufnahmen aufeinanderlegte und zu einer Art Lastwagenlärm vermengte.
Stummes Singspiel
Das ist nun die reine Gegenposition zu der Aufnahme von Mozarts «Entführung», die der Dirigent René Jacobs 2014 für Harmonia mundi erstellt hat (https://www.peterhagmann.com/?p=781). Im Gegensatz zur landläufigen Auffassung von Regisseuren glaubt Jacobs nicht nur an den Sprechtext der «Entführung», er gewinnt ihm sogar vieles ab, gerade weil er von den Sängern, selbst von den fremdsprachigen, so ungeheuer gut, nämlich konkret und fasslich gesprochen wird. Das Stück wird da jedenfalls ungeheuer, wenn auch unaufdringlich aktuell. Für derlei Ansätze hat eine Oper wie die in Zürich weder Sinn noch Zeit. Zudem ist mit David Herrmann ein junger Regisseur gerufen worden, der seine eigene Geschichte, nicht die Mozarts, erzählen möchte – und damit den Reflexions- und Erkenntnisprozess rund um «Die Entführung aus dem Serail» zu bereichern gedenkt. Das ist sein Recht, wenn nicht sogar seine Pflicht, denn auch Regisseure sind Interpreten – selbst dann, wenn sie bloss illustrieren. Die kleine Frage ist einfach, was von Mozarts Werk noch übrig bleibt, wenn seine eine Hälfte kurzerhand weggelassen und durch Erfindungen des Regisseurs ersetzt wird. Mozart? Herrmann?
Von Vorteil ist immerhin, dass durch den Ansatz David Herrmanns «Die Entführung aus dem Serail» aus der Islam-Debatte dieser Tage gelöst wird. Als Mozart das Stück schrieb, bildeten die Belagerung Wiens durch die Türken und die damit verbundenen Grausamkeiten noch absolut Teil des kollektiven Gedächtnisses. Der Klang der türkischen Schlaginstrumente bis hin zum Schellenbaum evozierte mehr oder weniger lustvolles Schaudern. Heute stehen wir an einem ganz anderen Ort, hat die Diskussion um den Islam und seine Auslegungen in Theorie und Praxis ganz andere Dimensionen angenommen. David Herrmann belässt es dabei, die couleur locale des Türkischen in Anspielungen und szenischen Randbemerkungen anklingen zu lassen: sie durch eine Kette arabischer Schriftzeichen zu evozieren, durch einen kurzen Auftritt von Choristen in Burkas und durch einen Anklang an Szenenbilder aus dem Theaterlexikon, ein liebevolles, sanft brechendes Zitat gegen Schluss der Oper. Das ist hic et nunc wohl doch eine sehr vertretbare Lösung.
Selbst der Bassa ist kein Pascha, zumal er ja nicht spricht. Er wird von Sam Louwyck verkörpert – und das in wörtlichem Sinn, denn der belgische Schauspieler, schlank, gross gewachsen, viril und agil, verfügt über eine sagenhafte szenische Präsenz. Er ist das, wovor sich Belmonte fürchtet, er ist jener Andere, der seiner Konstanze vielleicht auch noch gefiele. Womit angedeutet ist, was die Zürcher «Entführung» verhandelt: nicht die «Entführung», sondern Belmonte, seine Schwierigkeiten mit sich selber und sein Problem mit den Frauen. Nein, man muss noch einen Schritt weiterdenken: Es geht mehr noch um den Mann ganz allgemein, den Mann unserer Tage und seine heikle Befindlichkeit – denn Pedrillo und seine Blonde sind von der Kostümbildnerin Esther Geremus aufs Haar gleich eingekleidet. Beide Männer tragen die gleichen grauen Anzüge heutigen Schnitts, beide Frauen dieselben violetten Kleider. Der Unterschied zwischen dem hohen Paar und dem niederen der Diener ist eliminiert, die beiden Paare sind sozial so nivelliert, wie es diesen Tagen entspricht. Und von den beiden Männern ist der eine wie der andere: Hasenfuss und Grossmaul zugleich.
«Die Entführung aus dem Serail» demnach als Versuch, die Geschichte ganz aus der Sicht Belmontes zu erzählen, als seine ganz persönliche Imagination. Seinen Ausgang nimmt der Abend von dem Quartett am Ende des zweiten Akts, in dem die Fragilität der Beziehungen bei den beiden Paaren unverstellt ans Licht kommt. Das vermeintliche Gerücht, von dem Belmonte dort singt, ist der erste Satz. Er platzt mitten in die Ouvertüre hinein, und ausgesprochen wird er in einem gut besuchten Restaurant. Konstanze und Belmonte sitzen sich gegenüber; ihre Körpersprache lässt keinen Zweifel an der dicken Luft, die zwischen ihnen herrscht. «Man sagt», hebt er an, «nun weiter», antwortet sie – und dann schiesst es aus ihm heraus: «dass du die Geliebte des Bassa seist.» Worauf sie ihm ihr Mineralwasser ins Gesicht schleudert, sich erhebt sich und in der Toilette verschwindet: auf Nimmerwiedersehen.
Das ist das Trauma, aus dem sich im weiteren Verlauf die Geschichte eines fortwährenden Suchens, eines ängstlichen Beobachtens, eines selbstquälerischen Vermutens entwickelt – und das am Ende zur Wiederkehr des Anfangs führt. Wie auf einer Geisterbahn geht es zu. Zum surrenden Geräusch zwischen den Arien dreht sich die spektakuläre, in aller Einlässlichkeit ausgestaltete Bühne von Bettina Meyer, auf der das Öffentliche des Restaurants vom Privaten eines Schlafgemachs durch eine schmale Gasse zwischen hohen weissen Vorhängen getrennt ist. Und wie im Spiegelkabinett stösst Belmonte gegen Türen, die verschlossen bleiben, wo sie sich doch eben noch geöffnet haben, und tapst er an grosse Glasfenster, die ihn Dinge sehen lassen, die er besser nicht sähe.
Wunschkonzert mit Niveau
Das ist alles zum Teil sehr witzig angelegt und hochvirtuos durchgeführt – an guter Unterhaltung fehlt es nicht. Dennoch bleibt die Frage nach der Plausibilität; dies nicht zuletzt unter dem Eindruck, dass sich das Szenische wieder einmal verselbständigt und sich das Werk für die eigenen Interessen zunutze gemacht habe. Ist Belmonte tatsächlich die Hauptfigur, als den ihn die Inszenierung portiert? Ist er nicht vielmehr Teil eines von Mozart und seinen Librettisten sehr sorgfältig austarierten Ensembles, das durch den interpretatorischen Zugriff in Schräglage gerät? Oder dient er gar als Projektionsfläche für den Regisseur? Anlass zum Zweifel ist der Umstand, dass die dramatis personae für sich selbst genommen nicht wirklich das Profil erhalten, das ihnen der Komponist entwickelt hat.
Pavol Breslik vermeidet erfolgreich jede Larmoyanz, sein Belmonte bleibt aber trotz aller szenischen Präsenz mehr Figur als Charakter. Dasselbe gilt, logischerweise und abgewandelt, für Pedrillo als der Doppelgänger Belmontes, obwohl (oder gerade weil) Michael Laurenz sich während der Vorbereitungen zur Flucht polternd Mut macht. Dass diese Arie, in der sich Pedrillo frisch zum Kampfe ruft, ein heikles Unterfangen beschwört, den Versuch nämlich, den meist als Oberkellner kaschierten, allgegenwärtigen Aufpasser Osmin lahmzulegen und dann die beiden Damen zu befreien, das macht die Bühne nicht deutlich, man muss es wissen oder sich das Wissen vor der Vorstellung aneignen: Mozarts «Entführung» für Eingeweihte? Im übrigen ist der bedrohlich garstige Osmin von Nahuel Di Pierro neben seinem stummen Dienstherrn der einzige Mann vor Ort, der Biss hat. Äusserst klangvoll seine Stimme, fest in ihrer Tiefe verankert, dabei aber nie orgelnd – da könnte einem schon bang werden, gäbe er sich nicht am Ende als Theatertürke mit ordentlichem Krummsäbel zu erkennen.
Konturierter wirken die beiden Frauen – vor allem Konstanze. Olga Peretyatko für diese Partie zu verpflichten, war nicht ohne Risiko; ihre wunderbare Stimme hat Dimensionen angenommen, die über ein Kammerspiel wie die «Entführung» deutlich hinausreichen. Zwischendurch gibt sie ordentlich Gas, bleibt dabei aber doch stets im Rahmen der Gesamtbalance. Jedenfalls stören die Spitzen nicht, sie unterstreichen vielmehr den emanzipatorischen Zug, der in ihrer Figur angelegt ist – und was sie an technischen Wundern in ihren Auftritt einbaut, darf echt bewundert werden. Befremdlich nur, dass sie ihre beiden grossen Arien des zweiten Akts, die eine in g-moll und die Martern-Arie in C-dur, unvermittelt hintereinander zu singen hat – da führt sich des Regisseurs Versuch ad absurdum. Schade auch, dass Claire de Sévigné mit ihrem hellen, aber durchaus körperhaften Timbre die Blonde zur automatisch getriebenen Puppe machen muss. Das denunziert diese Erscheinung, die als Frau wie als Dienerin doch eigentlich einen doppelten Befreiungsversuch wagt.
Zum Schluss der Premiere schenkte das Publikum dem Bühnenteam ein heftiges Buh-Konzert, das hat in Zürich inzwischen wieder Tradition. Beim Erscheinen des Dirigenten gab es keinen Widerstand, dabei hat dieser schmächtige Junge in seinem zu grossen Anzug nicht weniger persönlich interpretiert und nicht weniger an den Rezeptionsmustern gekratzt als der Regisseur und seine Kolleginnen. Maxim Emelyanychev heisst der junge Mann; er ist kurzfristig in die Stelle von Teodor Currentzis getreten, der aus gesundheitlichen Gründen von seiner Mitwirkung hatte absehen müssen. Historisch informierte Aufführungspraxis ist hier kein Programm, sondern gelebtes Leben. Man hört es der Scintilla an, der Barockformation des Zürcher Opernhauses mit ihren alten Instrumenten, die so herrlich farbig klingen. Man entnahm es auch Einzelheiten wie den phantasievoll ausgeführten Kadenzen oder den Trillern, die nicht einfach ausgelassen, sondern explizit ausgeführt wurden – nämlich oft mit dem zugespitzt verlängerten Nebenton angefangen und dann brillant gesteigert wurden. Und an manchen Stellen hat der junge Dirigent Tempi angeschlagen, die im wörtlichen Sinn aufhorchen liessen. Wenn «Die Entführung aus dem Serail» auf der Zürcher Bühne ihren Boden verliert und zum szenisch aufgepeppten Wunschkonzert wird, so tut sie das doch auf denkbar anregendem Niveau.
*
La Scintilla – respektive die Bläserformation des Orchesters, die sich La Scintilla die fiati nennt – hat Mozarts «Entführung» bei Solo Musica (im Vertrieb von Sony) auf CD aufgenommen, dies in der ausnehmend schönen Bearbeitung für Harmoniemusik aus der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. Sehr zu empfehlen.